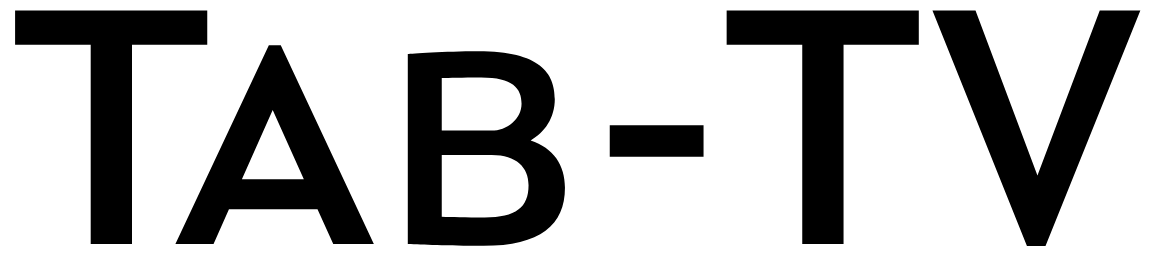Viele Käufer begannen, sich über die Fertigungsqualität von Waschmaschinen zu beschweren. Ein Gerät, das früher als Inbegriff der Zuverlässigkeit galt, erfüllte nicht mehr denselben Standard: Schon nach wenigen Jahren waren Reparaturen notwendig. Warum ist das passiert?
Die Entstehung des Waschmaschinenmarktes (1930–1950er Jahre)
Die Entwicklung der Branche wurde von vielen Faktoren geprägt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts besaßen nur 20–40 % der Haushalte eine Waschmaschine. Während des Zweiten Weltkriegs kam die Produktion zum Erliegen, da die Fabriken für militärische Zwecke umgerüstet wurden.
Als die Produktion in den 1950er Jahren wieder aufgenommen wurde, kehrten die Unternehmen in einen freien Markt zurück und sahen sich einem harten Wettbewerb gegenüber. Um Kunden zu gewinnen, setzten sie auf Qualität. Damals war der Kauf einer Waschmaschine eine große Investition für eine Familie, daher waren Zuverlässigkeit und Markenreputation entscheidend. Menschen fragten oft Freunde und Nachbarn nach ihren Erfahrungen, und Mundpropaganda wurde zu einem ausschlaggebenden Faktor.
Der Markt war offen, die Nachfrage enorm und Qualität der wichtigste Wettbewerbsvorteil.
Der Waschmaschinenmarkt (1950–1990)
In den Nachkriegsjahren waren die meisten Waschmaschinen vom Aktivator-Typ: ein Behälter zum Waschen und ein zweiter zum Schleudern. Erst Mitte der 1950er Jahre kamen die ersten vollautomatischen Waschmaschinen auf den Markt. Anfang der 1960er begannen die Hersteller, die Aktivator-Modelle schrittweise auslaufen zu lassen und sich ausschließlich auf automatische Maschinen zu konzentrieren.
Damit begann ein massiver Ersatzzyklus: Haushalte tauschten ihre alten Geräte gegen neue, die einfacher zu bedienen waren und weniger menschliches Eingreifen erforderten. Wieder einmal konkurrierten die Hersteller vor allem über die Qualität und boten zunehmend zuverlässige Geräte mit neuen Technologien an.
Ende der 1980er Jahre jedoch war der Markt gesättigt: Fast alle Haushalte hatten bereits moderne Waschmaschinen, und die alten Geräte waren weitgehend ersetzt. Die Hersteller standen nun vor einer neuen Herausforderung: Wie konnten sie in einem vollständig versorgten Markt weiter verkaufen?
Die Nachfrage nach Waschmaschinen (1990–2010)
Die frühen 1990er Jahre brachten große geopolitische und wirtschaftliche Veränderungen. Der Zusammenbruch der UdSSR eröffnete einen riesigen Markt, der lange Zeit für ausländische Waren verschlossen war, und beeinflusste auch Osteuropa. Gleichzeitig öffneten China und andere asiatische Länder ihre Volkswirtschaften, während sich die finanziellen Bedingungen in Mittel- und Lateinamerika verbesserten.
Zusammen schufen diese Entwicklungen enorme neue Märkte. Zwischen 1990 und 2010 wuchs die weltweite Nachfrage um rund 100 Millionen Waschmaschinen.
Für die Hersteller war dies ein gewaltiger Anreiz: neue Märkte, enormes Verkaufspotenzial und die erneute Notwendigkeit, Kundenloyalität zu gewinnen. Qualität wurde erneut zum Hauptverkaufsargument. Mit steigenden Einnahmen investierten die Unternehmen stark in neue Technologien und Designs. Außerdem wurden Bauteile so konstruiert, dass sie leicht reparierbar waren, was eine Massenproduktion mit zugänglichem Service unterstützte.
Waschmaschinen von 2010 bis heute: Trends und Veränderungen in den Verkaufsstrategien
Ab 2010 war der Waschmaschinenmarkt erneut gesättigt. Die Nachfrage sank drastisch, viele Unternehmen konnten nicht überleben — einige verschwanden vom Markt, andere wurden von größeren Konkurrenten übernommen.
Die Situation war paradox: Haushalte hatten bereits Waschmaschinen, die Nachfrage war minimal und die Produktion zunehmend unrentabel. Geräte aus den 1990er und 2000er Jahren waren noch auf Reparatur ausgelegt (eine Reparatur war wesentlich günstiger als ein Neukauf). Doch für Unternehmen reichte das nicht mehr.
Um zu überleben, brauchten sie neue Einnahmequellen. Es genügte nicht mehr, nur am Verkauf der Maschinen zu verdienen: Ersatzteile und Kundendienst wurden zu zusätzlichen Einnahmequellen. Doch das brachte ein Problem: Wie sollte man mit Ersatzteilen Gewinne erzielen, wenn die Maschinen zu zuverlässig waren und 10–20 Jahre ohne größere Defekte hielten?
Warum Waschmaschinen nicht mehr für die Ewigkeit gebaut werden
Im 21. Jahrhundert verkürzten die Hersteller bewusst die Lebensdauer von Waschmaschinen. Während in den 1990er Jahren eine Lebensdauer von 10–15 Jahren üblich war, sank sie bis 2010 auf nur noch 5–7 Jahre. Produktionskosten wurden gesenkt und Bauteile mit begrenzter Haltbarkeit entwickelt.
So wurden beispielsweise Trommeln unzerlegbar konstruiert: Die Lager wurden bei der Fertigung in den Bottich eingegossen, was bedeutete, dass bei einem Defekt der gesamte Bottich ausgetauscht werden musste — nicht nur ein Lager. Die Zahl der kleinen, austauschbaren Teile wurde auf ein Minimum reduziert. Dadurch kostete eine Reparatur oft 30–70 % des Preises einer neuen Maschine.
Die Hauptanforderung für Hersteller wurde einfach: Die Maschine musste die Garantiezeit ohne Ausfall überstehen. Danach war die Reparatur so teuer oder umständlich, dass es für die Kunden einfacher war, eine neue zu kaufen.
Das Problem der Premiummarken
Besonders stark litt darunter das Image von Premiummarken. Ein Kunde, der 1.500–2.000 $ für eine Waschmaschine ausgab, erwartete eine Lebensdauer von mindestens 10–15 Jahren, wie es in den 1990er und 2000er Jahren üblich war. Wenn das Gerät jedoch schon nach 4–5 Jahren ausfiel und die Reparaturen teuer waren — oft mussten Originalteile direkt beim Hersteller bestellt werden — fühlten sich Käufer betrogen.
Daraufhin wechselten viele zu günstigeren Alternativen. Denn wenn eine 400 $-Maschine ebenfalls 4 Jahre hielt, ließ sich deren Austausch leichter akzeptieren als derselbe Zeitraum bei einem teuren Modell. In der Praxis wurden Maschinen meist nur ein- bis zweimal repariert, bevor Kunden die Marke endgültig aufgaben. Schlechte Erfahrungen verbreiteten sich schnell durch Mundpropaganda und beschädigten langjährig aufgebaute Markenreputation.
Kurzfristige Gewinne, langfristige Verluste
Diese Situation war das Ergebnis kurzsichtigen Managements. Führungskräfte, die auf schnelle Gewinne setzten, reduzierten die Haltbarkeit, senkten Produktionskosten und verdienten an Ersatzteilen. Kurzfristig stiegen Umsatz und Erlöse um 200–300 %. Langfristig jedoch untergrub diese Strategie das Vertrauen in die Marke.
Das Problem verschärfte sich dadurch, dass diese Manager selten lange in einem Unternehmen blieben. Nachdem sie kurzfristige Erfolge erzielt hatten, wechselten sie zur nächsten Firma, wiederholten denselben Zyklus und hinterließen Reputationsschäden, die erst 10–15 Jahre später offensichtlich wurden.
Der Fall europäischer und amerikanischer Marken
Leider haben viele europäische Hersteller diesen Ansatz übernommen. Seit 2015 sieht sich etwa Miele wachsender Kritik wegen sinkender Haltbarkeit und komplizierter Reparaturen ausgesetzt. Auch Bosch und Siemens erhielten zunehmend Beschwerden über häufige Defekte.
Das Problem ist nicht, dass diese Firmen „schlechte“ Maschinen herstellen — im Allgemeinen sind es solide Produkte —, sondern dass bestimmte Komponenten bewusst mit begrenzter Lebensdauer konstruiert werden. Für eine Familie mit leichten Waschladungen von 3–4 kg kann die Maschine einige Jahre länger halten, während in Haushalten mit 5–6 kg Wäscheteile deutlich schneller verschleißen. Viele Kunden erleben daher bereits nach 3–4 Jahren Ausfälle.
Sogar General Electric, einst Marktführer mit fast 40 % Anteil am US-Markt, verkaufte 2016 seine gesamte Haushaltsgerätesparte — einschließlich Markenrechten — an den chinesischen Konzern Haier.
Die koreanische Ausnahme
Im Gegensatz dazu schnitten die koreanischen Giganten LG und Samsung etwas besser ab. Inspiriert von japanischen Praktiken setzten sie zunächst auf hohe Qualität und zuverlässigen Service. Mit der Zeit passten sie ihre Strategie an und fanden ein Gleichgewicht: Ihre Maschinen gelten im Allgemeinen als zuverlässig, und Ersatzteile sind weit verbreitet erhältlich — nicht nur für autorisierte Servicezentren, sondern auch für unabhängige Händler. Diese Zugänglichkeit trug dazu bei, das Vertrauen der Verbraucher zu erhalten und ihre Reputation auf dem Weltmarkt zu schützen.